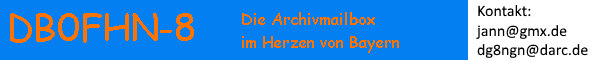| |
DJ1XK > VLF 19.02.99 12:01l 280 Lines 17165 Bytes #999 (999) @ DL
BID : J29DB0SIP01A
Read: DJ9TM GUEST
Subj: VLF-Bericht aus OLD MAN 2/99
Path: DB0ZKA<DB0LX<DB0CZ<DB0KFB<DB0SIP
Sent: 990219/0954z @:DB0SIP.#BW.DEU.EU [Konstanz OP: DJ1XK] BCM1.40m9
From: DJ1XK @ DB0SIP.#BW.DEU.EU (Jochen/A38)
To: VLF @ DL
Vorab: dies ist ein Artikel aus dem schweizerischen OLD MAN 2/99 - da nicht
alle VLF-Interessenten Zugriff zu dieser Zeitschrift haben hier der mit
Hilfe des DARC-Verlags (DANKE !) eingescannte Text - vy 73 Jochen DJ1XK
------------------------------------------------------------------------------
Ein Jahr auf Langwelle
Toni Baertschi (HB9ASB, Baechlisbrunnen, 1713 St. Antoni
Bisher war unser Mittelwellenband, 160 m, das "Topband". Das ist seit dem
1.1.1998 nicht mehr so, denn seit diesem Datum dürfen wir auch in der Schweiz
auf Langwelle funken, zwischen 135.7 und 137.8 kHz, auf 2200 m Wellenlänge.
Was ist bisher auf diesem neuen Band gelaufen, welches sind die Erfahrungen
des ersten Jahres ? Hier ein Bericht aus der Praxis.
Das Wichtigste mal vorneweg: 136 kHz ist kein "Plug and Play Band". Die meisten
Amateurfunkgeräte sind hier unten taube Nüsse und die gebräuchlichen 500 Hz
Filter wie Scheunentore in einem Einfamilienhaus. Sender gibt es keine zu
kaufen und für das zugelassene eine Watt ERP brauchts schon mal einige 100 W
bis 1 kW.
Die Antenne aber ist das "piece de resistance" bei der ganzen Geschichte. Es
braucht kein Viertelwellenstrahler zu sein, aber mit einer "feuchten Wäsche-
leine" wie auf KW geht's nicht. SWR-Meter und andere Messmittel für LW müssen
auch selber gebaut werden, doch kann man sich zur Not auch mit ein par pas-
senden Lämpchen als HF-Strommesser behelfen.
Die an der Antenne auftretenden Spannungen sind hoch (einige 10 kV) und die
Anforderungen an die Isolatoren deshalb für uns Amateure ungewohnt und die
Effekte manchmal recht überraschend, denn die Antenne hat eine gewisse
Ähnlichkeit mit einem Tesla-Transformator.
Gute Nachrichten gibt es für "CW-Fans": das Band ist CW only und zu schmal für
Fonie. Ausserdem sind die Signale nach einiger Entfernung sehr schwach. Für DX
sind nebst sehr schmalen ZF-Filtern unbedingt zusätzliche NF-Filter zu
empfehlen.
Ausserdem brauchts viel Geduld und gute Ohren. Aber nach einigen Abenden auf
Langwelle wird man sich schon daran gewöhnen, CW-Signale aus dem atmosphäri-
schen Störnebel heraus zu hören - nach zu langer Zeit am RX sogar auch dort,
wo keine sind, Hl.
Meine Station sieht heute so aus: Der Sender hat einen VFO, der auf 6.8 MHz
arbeitet und durch 50 geteilt wird. Er "läuft" deshalb pro Stunde weniger als
ein Hz. Ein VFO direkt auf 136 kHz wäre weniger stabil (Spule mit Ferritkern).
Die PA arbeitet im C-Betrieb mit zwei Power FET IRFP250 in push pull. Die HF-
Leistung beträgt etwas über 300W bei 33 V DC. Davon bleibt allerdings dann
nicht mehr viel übrig; bei mir etwa ein halbes Watt ERP.
Als Empfänger benutze ich einen Harris RF590 mit zusätzlichem Audiofilter
(Timewave DSP599zx) das ich bis auf 10 Hz Bandbreite herunter regeln kann.
Das wichtigste aber ist die Antenne. Dafür steht mir ein Grundstück von 30 mal
40 m zur Verfügung, also nicht einmal genügend Platz für einen gestreckten
fullsize Dipol für 160m. Ich habe deshalb eine vertikale Wendelantenne mit 15m
Höhe gebaut. Auf den unteren 7m ist der Draht auf ein PVC-Abflussrohr mit 11cm
Durchmesser gewickelt, der obere Teil besteht aus einer Kevlar-Fischrute.
Als Dachlast dient meine 160m-Antenne, ein 60m-Draht der im Zick-Zack zwischen
18m und 9m Höhe übers Grundstück gespannt ist. Die Antenne hat eine Eigen-
resonanz bei etwa 200 kHz und wird am Fusspunkt über einen Autotrafo
(aufgewickelt auf einen Plastikpapierkorb) an das Koaxialkabel angepasst.
Als "Erde" habe ich so zirka alles zusammen gehängt, was irgendwie nach einem
Leiter aussah, inklusive Gartenzaun. Als Empfangsantenne dient mir nebst der
Sendeantenne zuweilen auch ein drehbarer Rahmen von einem Meter Durchmesser,
aber meistens macht die Sendeantenne auch beim Empfang das Rennen.
Nun aber zu den wichtigsten Langwellen-Ereignissen des Jahres:
Begonnen hatten meine Experimente mit einer Enttäuschung: Mit einem kleinen
Transistorradio mit BFO und Ferritantenne konnte ich meinen Sender bereits nach
einer halben Wellenlänge Entfernung nicht mehr hören.
Beinahe hätte ich nach diesem Versuch aufgegeben und die Antenne wieder
abgebaut, denn das Resultat schien mir realistisch zu sein. Die Antenne war ja
so winzig klein im Vergleich zur Wellenlänge von 2200 m ! Und da waren noch
diese alten Bücher mit Beschreibungen von riesigen Sendeantennen und enormen
Sendeleistungen - QRP auf Langwelle - das konnte ja nicht weiter als bis zur
nächsten Hausecke funktionieren !
Schon bald aber klappten erste Cross-Band Verbindungen mit Schweizer Stationen
(meistens mit QSX auf 160 oder 2m). Das Band wurde offenbar fleissig abgehört
und ich bekam eine Menge Empfangsberichte. Mittlerweile ist dieses Interesse
aber stark abgeklungen und Rückmeldungen sind selten geworden.
In der Zwischenzeit habe ich auch begriffen, dass mein Transistorradio eine
magnetische und mein Sender eine elektrische Antenne hat und dass das im
Nahfeld wohl eine Rolle spielen muss.
Am 1.2.98 war es dann soweit ! Die verabredete Verbindung mit Paul HB9DFQ kam
zustande. Dies über eine Distanz von mehr als 100km. Die Signale waren
allerdings sehr schwach und an der Grenze der Verständlichkeit. Nun, 100 km war
ja schon ein Hoffnungsschimmer und ich begann mir auszurechnen, dass ich mit
optimierter Antenne und mehr Sendeleistung vielleicht so an die 200 bis 300 km
überbrücken könnte. Aber am Abend des 7. Februar hörte ich zum ersten Mal ein
Signal, das mich vom grossen DX träumen liess: Peter G3LDO von der Südküste
Englands, war mit seinen Testsendungen schwach aber klar auf meinem alten Drake
R4B mit Eigenbaukonverter zu hören. Wenn ich genau hinsah bewegte sich sogar
das S-Meter ein wenig !
Im Februar arbeitete ich dann mit den restlichen Schweizer Stationen: Berth
HB9DCE und Marco HB9BGG. Weitere sind bis heute leider nicht dazu gekommen.
Nun - der Frühling verging recht ereignislos. Marco verschwand wieder vom Band
und die Verbindungen mit Berth und Paul wurden immer zuverlässiger und stärker.
Bei CQ-Rufen mit QSX 80 m kamen nun auch Crossband-Verbindungen mit ausländi-
schen Stationen zustande. So die erste mit Andre F6CNI aus JN19QB (ja, wir
brauchen den VHF-Locator auch auf Langwelle !) und eine Woche später mit seinem
Vater Andre HB9DB.
So gegen Sommer tauchte dann eine Station mit einem superstarken Signal auf dem
Band auf: LX1PD. Er kam wesentlich stärker rein als die Schweizer Stationen und
es war frustrierend, seinen Testsendungen zuzuhören und nie eine Antwort auf
einen Ruf zu bekommen. Erst später, als dann Jules QSL für die Erstverbindung
LX-HB9 bei mir eintraf, lüftete sich das Geheimnis in der Form von 16 Stück
PL36 (Für jüngere OM: TV-Zeilenendröhren) und einer sehr professionell
aufgebauten Antenne.
Eigentlich hatte ich während den Sommermonaten nicht viel von der langen Welle
erwartet. Ich dachte, dass die Gewitterstörungen noch viel schlimmer als im
160 m Band sein müssten. Wahrscheinlich musste ich mit weiteren Versuchen bis
zum nächsten Winter zuwarten. Nun, da lag ich aber gründlich falsch, denn ge-
rade der August brachte den Durchbruch: am 5. August konnte ich endlich G3LDO
erreichen. QRB 721km, die Erstverbindung mit England war geschafft. G3GRO und
G3WSC folgten ein par Wochen später. Auch im August fand die erste Alpen-
überquerung statt, ein schwieriges Unterfangen, müssten wir doch feststellen,
dass die Bodenwelle im Gebirge offenbar stark gedämpft wird. Ein Umstand, der
sich später noch bestätigen sollte. HB9DCE/p funkte von Laax aus auf der langen
Welle und unsere gegenseitigen Rapporte waren sehr dünn und an der Aufnahme-
grenze.
Natürlich wurde der Sommer fleissig genutzt um die Antenne und deren Anpassung
weiter zu verbessern. Aber irgendwann war die Grenze des Zumutbaren für Familie
und Nachbarn erreicht.
Versuche mit einer normalen Marconi-Antenne mit gleicher Höhe wie die Helical
brachten ein um -3dB schlechteres Resultat und wurden abgebrochen. Trotz des
(im Verhältnis zur Länge) geringen Durchmessers schien sich die Wendelantenne
zu bewähren. Ich konzentrierte meine Verbesserungsaktionen in den verbleibenden
Sommerferien auf die Verbesserung meines "Erdnetzes" um so den Wirkungsgrad der
Antenne noch etwas zu erhöhen. Allerdings brachten die vielen zusätzlichen
Drähte bloss Schwierigkeiten beim Rasenmähen und keine wesentliche Erhöhung
des Antennenstromes. Offenbar war meine Erdung mit dem Wasserleitungs-, Strom-
und Kabelnetz bereits klar definiert und kaum mehr zu optimieren.
September und Oktober vergingen, ohne dass ich neue LF-Stationen arbeiten
konnte; dafür aber eine Vielzahl von Crossbandverbindungen mit Deutschland und
Frankreich, was das Interesse in diesen Ländern für die Langwelle dokumentierte.
Aber vielleicht ist das Interesse gerade dann am grössten, wenn man etwas (noch)
nicht haben darf: In DL und F war das neue Band 1998 noch nicht zugelassen.
Die Franzosen hoffen auf 1999, aber unsere deutschen Freunde scheinen z.Z. kein
gutes Verhältnis mit ihren Behörden zu haben. Die Prognosen tönen daher nicht
gerade optimistisch. Irgendwie tragisch, denn es waren gerade die deutschen
Funkamateure, welche sich sehr für ein Langwellenband in Europa eingesetzt
hatten. Bloss Peter, DJ8WL, war unter DAOLF im Frühling mit einer Sonderlizenz
zu hören. Allerdings nicht hier im Freiburgerland, irgenwie hat das Emmental
die verbliebenen dBs weggefressen oder mein RX war dazumal noch zu schwach.
Aber Paul HB9DFQ gelang es, mit Peter ins QSO zu kommen (Erstverbindung HB-DL).
Der November hauchte der langen Welle dann weiteres Leben ein. Erstmals tauchte
eine Station aus Italien auf: Marco, IK10DO, in der Nähe von Turin, war mit
einem schwachen Test-Signal zu hören. Auf meine Anrufe reagierte er aber
vorerst nicht und als ich hörte, dass er etwa die gleiche Leistung wie ich
(ca. 0.5 W ERP) hafte, erinnerte ich mich wieder an die Versuche mit HB9DCE/p
in Laax und den Schwierigkeiten mit der Langwelle in den Alpen.
Nachts kam er aber zuweilen wesentlich stärker rein. Allerdings nur für kurze
Zeit und mit starkem QSB. Trotzdem, nach einigen Fehlschlägen schafften wir
dann doch noch ein QSO am 15. November.
Aber auch England hatte aufgerüstet und brachte mir weitere QSOs mit G4GVC,
G3YXM und G3KEV in Scarborough. Letztere Verbindung war bis dahin meine bisher
grösste Distanz: 993 km und der Rapport von 539 liess noch Hoffnung auf ein
paar weitere Kilometer in diese Richtung - vielleicht gar GM oder El ?
Dazu sollte es 1998 allerdings nicht mehr kommen (es sei denn heute Morgen ?);
dafür hielt das Band noch ein par andere Überraschungen parat: am 21.11. konnte
mit Gaspard ON4ZK die Erstverbindung mit Belgien gefeiert werden. Kurz darauf
konnten auch die restlichen belgischen Langwellen-Stationen gearbeitet werden:
ON7YD und ON6ND.
Am 6.12. war dann die Erstverbindung mit Wales fällig. Steve GW4ALG kam zwar
nur dünn mit 339 rein, ich erhielt von ihm jedoch 559.
All diese Verbindungen fanden entweder am Vormittag oder am Abend statt.
Morgens gab es jeweils ein Maximum für die Tagesausbreitung, das im August so
zwischen 08:00 und 09:00 und im Winter zwischen 09:00 und 10:00 Lokalzeit lag.
Am Abend waren die Feldstärken zwar höher, dafür aber auch der Geräuschpegel.
Das Maximum trat hier im Sommer, wie im Winter zu recht unterschiedlichen
Zeiten auf, manchmal bereits um 19:00, vielfach aber auch erst so gegen 22:00
Lokalzeit. Abends ist aber diese Zeit, in der auch die kommerziellen Sender
manchmal 20 bis 30 dB über dem Normalwert liegen oft nur kurz und dauert
vielfach nur etwa 10 Minuten bis maximal eine halbe Stunde. Störend ist dabei
häufig der Luxemburgeffekt, bei dem ein Langwellensender von einem anderen
direkt an der Ionosphäre moduliert wird. So hört man denn oft Musik- oder
Gesprächsfetzen "übers Band wehen" (z.B. DCF39 auf 138.830 wird von Langwellen-
sendern aus dem Rundfunkband moduliert!).
Schade dass die LF-Enthusiasten keine Frühaufsteher sind. Einige Beobachtungen
im Dezember zeigten ausserordentlich gute Bedingungen in der zweiten Nachthälf-
te.
Die Langwelle ist also auch bei 136 kHz keineswegs so stabil wie das oft
beschrieben wird. Nebst den positiven Spitzen gibt es natürlich auch die
unterdurchschnittlichen Zeiten, besonders während der Dämmerung. Die
Signaleinbrüche können da ohne weiteres 40 dB ausmachen. Allerdings höre ich
von Stationen aus dem Flachland, in der Nähe des Meeres, dass dort die
Ausbreitungskapriolen nicht so ausgeprägt seien und die Signale stabiler.
Wahrscheinlich sind wir hier in den Alpen mehr auf die lonosphärenausbreitung
angewiesen und weniger auf die stabilere Bodenwelle. Allerdings ist mir vieles
in diesem Zusammenhang noch unklar. Rudi HB9T hat mir aber viele interessante
Hinweise auf alte Literatur gegeben, in der die Langwellenausbreitung beschrie-
ben wird und damit doch einiges Licht in das Dunkel gebracht.
So konnte ich denn auch nachvollziehen, wie gross der Einfluss magnetischer
Stürme auf die Langwellenausbreitung ist und verfolge seither mit Interesse die
Entwicklung des Kp-Index via Internet. Bei und nach starken Störungen des Erd-
magnetfeldes werden in der Regel die Tagesfeldstärken angehoben, die Nachtaus-
breitung wird jedoch beeinträchtigt.
Ach ja, da gibt es auch noch die lokalen Ausbreitungseinflüsse: Meine Antenne
steht mitten zwischen den Bäumen und jetzt im Winter, wenn die Blätter gefallen
sind und der Saft in die Wurzeln zurück kehrt, ist mein Signal deutlich
kräftiger geworden.
Nun, heute ist das Jahr und damit auch das erste Langwellenjahr zu Ende, aber
meine Geschichte noch nicht ganz. Vorletzte Nacht, so gegen 21:00 Lokalzeit,
lagen die Signale der kommerziellen Stationen wieder einmal kräftig im Plus und
ich startete deshalb einen CQ-Ruf. Diese halte ich übrigens wegen der geringen
Bandaktivität meistens länger, so zwischen 5 und 15 Minuten.
Das würde auf KW wohl Entrüstungsstürme entfachen. Nun auf Langwelle ist das
(noch) etwas anders. Nach meinem Ruf sah ich auf dem Spektrogramm des Computers
ein schwaches Signal. Zwar noch nicht hörbar, aber von Minute zu Minute stärker.
Zuerst konnte ich ein O ausmachen, dachte an eine ON Station, lehnte mich
zufrieden im Stuhl zurück ..... um gleich danach ungläubig nach dem Kopfhörer
zu greifen: Nun kam ganz klar Reino, OH1TN, aus dem Geräuschpegel raus. Sein
QTH liegt in KP1100 bei Tampere, nördlich von Helsinki, 1932 km von mir ent-
fernt. Ich traute meinen Ohren kaum. Natürlich wusste ich vom Internet, dass er
auf Langwelle QRV ist, doch gehört hatte ich ihn noch nie !
Rasch machten wir ein QSO, bevor - zehn Minuten später - die Signalstärken
wieder zurück gingen und er im Rauschen verschwand.
Wie ich heute erfahren habe, ist das ein neuer Weltrekord auf 136 kHz, aber ich
glaube, dass der nicht lange halten wird. Die Condx auf 160m seien übrigens
auch ausserordentlich gut gewesen zu jener Zeit.
Der nächste Schritt wäre dann wohl die Überquerung des Atlantiks, aber dazu
braucht es wahrscheinlich noch so 20 bis 40 dB mehr. Unmöglich ist das nicht,
habe ich doch vorhin meinen Computer erwähnt, der in der Zwischenzeit am
Langwellen-RX hängt. Im Prinzip mag ich keine Computer im Shack. Sie verseuchen
den Äther mit HF und wenn ich schon den ganzen Tag mit so einer Kiste arbei-
ten muss, bzw. darf, so möchte ich doch in der Regel computerlos funken. Doch
für Langwelle hat das Ding echt starke Vorteile. Über die Soundkarte kann ich
mittels FFT ein Band von einigen 10 Hz mit einer Auflösung von z.Z. 0.3 Hz auf
einem scrollenden Display betrachten (Wasserfall-Anzeige). Da werden nun
Signale sichtbar, die von Ohr absolut nicht mehr zu hören sind, auch nicht mit
dem Einsatz von sehr guten NF-Filtern. Wenn man jetzt ganz langsame Morsezeichen
verwendet, also z.B. mit Punktlängen von 3 Sekunden, werden die Signale auf dem
Bildschirm lesbar. Zwar dauert so ein QSO dann bis zu einer Stunde, aber das
ist auch bei anderen speziellen Betriebsverfahren so (z.B. Meteorscatter).
Diese "Videography" könnte der Schlüssel zu grösseren Entfernungen im Langwel-
lenband sein; zudem würde das an und für sich schmale Band von 2,1 kHz dann
plötzlich riesengross und deshalb auch noch viel mehr Aktivität vertragen.
Auch gibt es im Küstenbereich sehr starkes QRM durch Splatter des LORAN-
Navigationssystems auf 100kHz. Ein Grund übrigens, wieso mich G3LDO zu Beginn
nicht hören konnte. Mit der "Videography" können wir uns aber problemlos in
eine Lücke des LORAN-Gartenzaunes setzen und QSO fahren.
So, das ist das Ende meines Berichts. Wenn ihr mehr wissen wollt, so gebt
einfach "136 kHz" oder eines der oben angeführten Rufzeichen in irgendeine
gescheite Suchmaschine im Web ein und ihr werdet eine neue Welt entdecken.
Während ich diese Zeilen schreibe, läuft mein automatischer Morsegeber auf
136.800. Die Bedingungen sind gut und ich hoffe auf ein Signal von G3YXM/p
aus Dumfries in GM. Vorhin hatte ich gerade wieder ein QSO mit John G4GVC aus
Leicester, eines von mehr als 120 QSOs 1998 in unserem neuen Topband.
Sylvester 1998, Toni Baertschi, HB9ASB
------------------------------------------------------------------------------
Read previous mail | Read next mail
| |