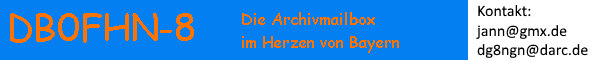| |
DJ1XK > VLF 19.02.99 09:20l 185 Lines 9192 Bytes #999 (999) @ DL
BID : J29DB0SIP00G
Read: DL9EM DJ9TM GUEST
Subj: VLF-Bericht aus OLD MAN 6/98
Path: DB0ZKA<DB0KFB<DB0CZ<OE9XPI<DB0SIP
Sent: 990219/0714z @:DB0SIP.#BW.DEU.EU [Konstanz OP: DJ1XK] BCM1.40m9
From: DJ1XK @ DB0SIP.#BW.DEU.EU (Jochen/A38)
To: VLF @ DL
Vorab: dies ist ein Artikel aus dem schweizerischen OLD MAN 5/98 - da nicht
alle VLF-Interessenten Zugriff zu dieser Zeitschrift haben hier der mit
Hilfe des DARC-Verlags (DANKE !) eingescannte Text - vy 73 Jochen DJ1XK
Die unten genannten Bilder und einige Formeln (die sich hier nicht gut
wiedegeben lassen) sind als .JPG im Archiv VLF-HB9.LZH enthalten !
------------------------------------------------------------------------------
Aufbau einer Station für das Langwellenband 137 kHz
Paul Schenkel (HB9DFQ), im Spannrain 20, 8105 Watt
Seit Beginn 1998 steht uns der Frequenzbereich von 135.7 - 137.8 kHz zur
Verfügung. Mein Ziel war es, mit möglichst wenig Aufwand QRV zu werden.
Dazu benötigt man im Prinzip einen Sender, einen Empfänger und eine Antenne.
Die dazu notwendigen Geräte muss man sich zum Glück weitgehend selber bauen.
Im Prinzip sind die dabei auftretenden technischen Probleme viel einfacher
lösbar als z.B. beim Bau eines KW-Transceivers. Die in der Schaltung unvermeid-
baren Streu-Induktivitäten und Streu-Kapazitäten sind praktisch vernachlässig-
bar, sodass man mit einigen einfachen Berechnungen schon brauchbare Resultate
erreicht. Aussergewöhnlich sind nur die Werte der einzelnen Komponenten und die
Spannungen an der Antenne. Ausserdem kann man im Selbstbau wieder einmal etwas
erreichen was mit handelsüblichem Amateur-Equipment noch nicht möglich ist.
Über die Ausbreitungsbedingungen habe ich keine Erfahrung. Bisher hatte ich
mehrere CW-QSOs mit HB9ASB (Distanz: 112 km, RST=569) und HB9BGG (Distanz:
10 km, RST= 599).
Ausserdem habe ich noch mehrere Empfangsrapporte aus Zürich, München und
Frankfurt erhalten.
1. Empfänger:
Die meisten KW-Transceiver haben einen durchgehenden Empfänger der schon ab
100 kHz funktioniert. Ich verwende einen IC-735.
Man stellt jedoch schnell fest, dass dieser Empfänger von den starken Rundfunk-
signalen übersteuert wird. Abhilfe schafft ein Tiefpass oder Bandpass-Filter am
Empfänger-Eingang (Bild 1). Ausserdem ist ein CW-Filter mit 250 Hz Bandbreite
im KW-Transceiver empfehlenswert. Da der CW-Empfang auf dem unteren Seitenband
erfolgt, sollten alle Empfangssignale höher tönen, wenn man die Empfangsfre-
quenz höher einstellt. Sollte es dabei Signale geben, bei welcher die NF tiefer
klingt, muss es sich um Intermodulationen oder andere Fehler im Empfänger
handeln. Falls kein geeigneter Empfänger zu Verfügung steht, kann man sich
einen Konverter bauen.
2. Sender:
Im freigegebenen Frequenzbereich von 135,7 - 137,8 kHz wäre es theoretisch
möglich, ein SSB-Signal mit 2,1 kHz Bandbreite unterzubringen. Aus folgenden
Gründen habe ich mich für den Bau eines einfachen CW-Senders entschieden:
- SSB-Sender sind um ein Vielfaches aufwendiger zu bauen.
- einen CW Sender kann man in 3 Feierabenden bauen.
- es gibt keine Stationen, welche auf SSB QRV sind.
- die Signale sind auf 137 kHz sehr schwach.
- es gibt zuviel QRM im freigegebenen Frequenzbereich.
- die Bandbreite des Antennensystems ist kleiner als die Bandbreite eines
SSB Signals (siehe Abschnitt 3: Antenne)!
Die ersten QSOs habe ich mit 50 Watt Sendeleistung durchgeführt. Gemäss den
Konzessionsbestimmungen ist eine maximale Sendeleistung von 1 Watt ERP
(effective radiated power) erlaubt. Da jedoch der Wirkungsgrad meiner Antenne
höchstens 0,5 % beträgt, wird die maximal erlaubte Sendeleistung nicht erreicht.
Bild 2 zeigt das Blockschema des Senders. Der VFO besteht aus einem freischwin-
genden Oszillator, welcher in einem abgeschirmten Gehäuse untergebracht ist.
Die exakte Sendefrequenz kontrollierte ich mit einem FrequenzZähler. Die
Sendeleistung wird mit einem Power MOSFET IRF530 erzeugt.
Bei einer Stromversorgung von 24 Volt und 3 Ampere erreicht der Sender eine
Ausgangsleistung von ca. 50 Watt (50Vrms an 50ü). Im Sender treten nur unge-
fährliche Spannungen auf. Bei den Kondensatoren und den Induktivitäten muss
man darauf achten, dass diese im Betrieb nicht warm werden. Als Induktivitäten
habe ich nur Luftspulen verwendet. Ein kompakter Aufbau ist jedoch nur mit
geeignetem Ferritmaterial möglich.
3. Antenne:
Die Antenne ist wohl die heikelste und die am schwierigsten zu berechnende
Komponente. 137 kHz entsprechen einer Wellenlänge von 2300 m. Eine sehr gute
Antenne wäre eine Lambda/4-Vertikal: aber auch eine Lambda/4-Horizontal ist -
von Ausnahmen abgesehen - noch jenseits von Gut und Böse (Länge: 575 m!).
In der Literatur sind meistens Vertikal-Antennen mit einer Dachlast-Kapazität
beschrieben. Der Bau einer solchen Antenne ist jedoch mit viel Aufwand
verbunden. Da ich für das 160m Band bereits einen 70 m langen Draht als Antenne
benutze, wollte ich mit demselben Draht auch meine 137 kHz Versuche durchführen.
Für erfolgreiche Versuche ist es wichtig, möglichst alle Parameter zu kennen
respektive durch Messungen und Berechnungen zu bestimmen.
Das Ersatzschema für ein Antennensystem mit Ladespule (Bild 3) ist anwendbar,
solange die Antennenlänge viel kürzer als Lambda/4 ist.
Der Strahlungswiderstand Rs ist vernachlässigbar klein gegenüber dem Verlust-
widerstand Rv. Der Wirkungsgrad der Antenne ist gleich dem Strahlungswiderstand
dividiert durch den Verlustwiderstand. Der Strahlungswiderstand nimmt mit der
Drahtlänge und der Höhe zu, er kann jedoch bei gegebenen Abmessungen nicht
stark vergrössert werden. Der Verlustwiderstand kann durch eine geeignete
Konstruktion der Ladespule möglichst klein gehalten werden.
Um den Sender an die Widerstände Rv + Rs anzupassen, wird mit der Induktivität
der Ladespule L die Antennen-Kapazität C so abgestimmt, dass sich die Reaktanzen
XI und Xc kompensieren. In diesem Fall kann am Fusspunkt der Ladespule ein rein
ohmscher Widerstand gemessen werden. Mit einem Signal-Generator und einem
2-Kanal-Oszilloskop kann die Resonanzfrequenz und der Verlustwiderstand Rv
gemessen werden, indem der Messwiderstand Rx so verändert wird, dass bei der
Resonanzfrequenz U1 doppelt so gross ist wie U2 (siehe Bild 3).
Die Kapazität C eines horizontalen Antennendrahtes und die dazugehörende
Ladespule können näherungsweise wie folgt berechnet werden:
((siehe Grafik OM5-98-4))
L: Induktivität der Ladespule [H]
C: Kapazität des Antennendrahtes [F]
f: Frequenz [Hz]
((folgt Grafik OM5-98-6))
Zusammenfassung der wichtigsten Größen meiner Antennen-Anlage:
Antennenlänge: LA = 70m
Antennenhöhe: h = 4...9m
Induktivität der Ladespule: L = 3.4 mH
Spulendurchmesser: d = 50 cm
Drahtquerschnitt: q = 0.75 mm^2 PVC isoliert
Windungszahl: n = 76
3dB-Bandbreite des Antennen-Systems: B = 1000 Hz (+/- 500 Hz)
Antennenstrom bei 50 Watt IA = 1.5 A rms
Spannung an der Antenne: UA = 4400 V rms
Strahlungswiderstand: Rs = ca. 10O mOhm (nicht verifiziert)
Verlustwiderstand: Rv = 22 Ohm
Wirkungsgrad: eta = 0.5%
Abgestrahlte Leistung: P =n 0.25 W
Praktische Hinweise für den Betrieb:
Aus den Werten für L, C und Rs kann leicht berechnet werden, dass die Band-
breite im Vergleich zu Kurzwellen-Antennen sehr gering ist.
Nur mit grossem schaltungstechnischen Aufwand könnte man die Bandbreite ohne
Leistungsverluste noch vergrössern.
Wenn die Sendefrequenz um 100 Hz geändert wird, ist das am SWR-Meter bereits
messbar.
Bei einer Frequenzänderung von ca. 200 Hz muss man die Ladespule wieder neu
abstimmen. Dies kann mittels Abgriffen oder durch Zusammenschieben oder
Auseinanderziehen der Windungen erreicht werden. Je nach Wetter ändert die
Resonanzfrequenz der Antenne um ca. 600 Hz.
Der Antennendraht sollte von allen Gegenständen wie Hausmauern oder Ästen um
mindestens 10 cm entfernt sein. Die Ladespule sollte sich ausserhalb des Hauses
befinden. Für die Ladespule und den Antennendraht habe ich PVC-isolierten
Kupferdraht verwendet.
Die Ladespule muss vom Regen abgeschirmt werden, da sonst die dielektrischen
Verluste untragbar hoch werden.
Es ist ein möglichst geringer Verlustwiderstand anzustreben. Dazu ist ein
Spulendurchmesser von 50 cm oder grösser empfehlenswert.
Für die laufende Überwachung und die Abstimmung der Antenne hat sich ein
selbstgebautes Reflektometer bewährt (siehe Abschnitt 5).
4. Anpassung an den Sender:
Um den Fusspunktwiderstand des Antennensystems von Rv = 22 Ohm an den Ausgangs-
widerstand des Senders von R = 50 Ohm anzupassen, ist ein Kondensator Cx (26 nF)
am Fusspunkt der Ladespule notwendig (Bild 4).
Die Zusatzinduktivität Lx des Anpassgliedes ist im Vergleich zu L sehr klein
(40 |JH) und kann in die Ladespule L integriert werden.
Der Kondensator Cx hilft auch die vorhandenen Oberwellen zu dämpfen. Eine
Anpassung ist nur möglich, wenn der Fusspunktwiderstand kleiner als 50 Ohm
(Senderausgang) ist.
Berechnung des Kondensators Cx wenn Rv bekannt ist:
((folgt Grafik OM5-98-8))
Zahlenbeispiel:
Cx = 26 nF, f = 137 kHz -> Rv = 22 Ohm
5. Reflektometer:
Für die laufende Überwachung und die Abstimmung der Antenne hat sich ein
selbstgebautes Reflektometer bewährt (Bild 5). Der kapazitive Spannungsteiler
muss auf bestes Vor-/Rückverhältnis abgeglichen werden (Messung mit
Dummy-Load; 4700 pF Kondensator anpassen).
----------------------------------------------------------------------------
Read previous mail | Read next mail
| |